Im Zivilprozess gilt grundsätzlich eine ganz einfache und eingängige Regel: Wer etwas vorträgt, das zu einem für ihn gewünschten rechtlichen Ergebnis führen soll, der muss dies auch beweisen. Dass das sinnvoll ist, dass weiß jeder gute Beamte, lautet doch Regel Nr. 3 des Beamten-Dreisatzes: “Da könnte ja jeder kommen!”.
Also muss die Partei eines der in der ZPO genannten Beweismittel benennen, nach dessen Erhebung das Gericht sich wie gewünscht überzeugt haben soll. Die häufigsten Beweismittel sind der Zeugenbeweis (zugleich der unzuverlässigste), der Augenschein und das Sachverständigengutachten.
Problematisch wird es für die beweisbelastete Partei – und in der Folge auch für ihren Anwalt – wenn, wie recht häufig, keine Beweismittel existieren außer die eigene Wahrnehmung der Partei und auch keine objektiven Tatsachen vorhanden sind, an die ein Sachverständiger anknüpfen könnte. Denn der Vortrag der Partei ist grundsätzlich nicht ausreichend, wenn der Gegner ihn bestreitet. Denn der Gegner kann in der Regel keinen Gegenbeweis führen, dass etwas gerade nicht geschehen ist.
Ganz unmöglich ist es jedoch nicht, die Partei wie einen Zeugen zu vernehmen. Hierzu hat der Gesetzgeber nämlich die Parteieinvernahme (§§ 447 ff. ZPO) geschaffen. So ist die Einvernahme einer Partei dann möglich, wenn dies beantragt wird und der Gegner ihr zustimmt. Das Ziel eines taktisch denkenden Anwalts wird daher immer sein, die Einvernahme der eigenen Partei zu erreichen und die Einvernahme der gegnerischen Partei zu verweigern.
Stimmt der Gegner nicht zu, so regelt § 448 ZPO, dass das Gericht die Einvernahme auch von Amts wegen “ohne Antrag einer Partei und ohne Rücksicht auf die Beweislast” durchführen kann, wenn “das Ergebnis der Verhandlungen und einer etwaigen Beweisaufnahme nicht ausreicht, um seine Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer zu erweisenden Tatsache zu begründen. Erforderlich ist daher, dass der Träger der Beweislast bereits einen Anfangsbeweis erbracht hat und eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die zu beweisende Tatsache spricht (h. M.). Kann der Beweisbelastete also nicht einmal Anknüpfungspunkte beweisen, aus denen sich die Wahrscheinlichkeit für die zu beweisende Tatsache ergibt, so scheidet die Parteieinvernahme von Amts wegen aus (vgl. LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 15.05.2002 – Az. 10 Sa 69/02).
Erforderlich ist zusätzlich, dass die Tatsache, der zu beweisen ist, möglichst genau substantiiert wird. Denn wenn es zu einer Parteieinvernahme kommt, trägt der Gegner nun die Beweislast dafür, dass der Vortrag unwahr ist. Einen Negativbeweis zu führen ist jedoch in der Regel nur dann möglich, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Behauptung gar nicht zutreffen kann. Hierzu ist aber erforderlich, zu wissen, wann wie wo was genau geschehen sein soll.
An diesen Hürden dürfte in dem Fall, der mich gestern zum Arbeitsgericht geführt hat, die Gegenseite scheitern.
Es ging, wie so oft, um die Frage, ob eine Kündigung übergeben wurde oder nicht. Die Gegenseite sagt: Ja, aber die Parteien waren unter sich. Unser Mandant sagt: Nein, eine Übergabe gab es nicht. Beweisangebot für die Übergabe? Die Einvernahme des Geschäftsführers der Gegenseite.
Im Termin zur Güteverhandlung (2. Runde) wurde der Geschäftsführer befragt, wann denn die Übergabe stattgefunden haben soll. Das wisse er nicht mehr, das merke er sich doch nicht. Weder den Tag konnte er genau sagen (“müsste der Tag gewesen sein”), noch die Uhrzeit. Nur dass der Mandant zu ihm ins Büro gekommen sei. Was aber auch häufig geschehen ist, weshalb dies sicher keinem Kollegen aufgefallen sein dürfte. Den Kollegen habe er von der Kündigung auch erst Wochen später berichtet – nachdem schon Kündigungsschutzklage erhoben war.
Das Gericht hat folgerichtig zu erkennen gegeben, dass es keine Grundlage für die Parteieinvernahme erkennen kann. Das hat leider nicht gereicht, um den Geschäftsführer zu einem Vergleich zu bewegen. Dann wird es halt voraussichtlich deutlich teurer für ihn. Freut den Mandanten auch.

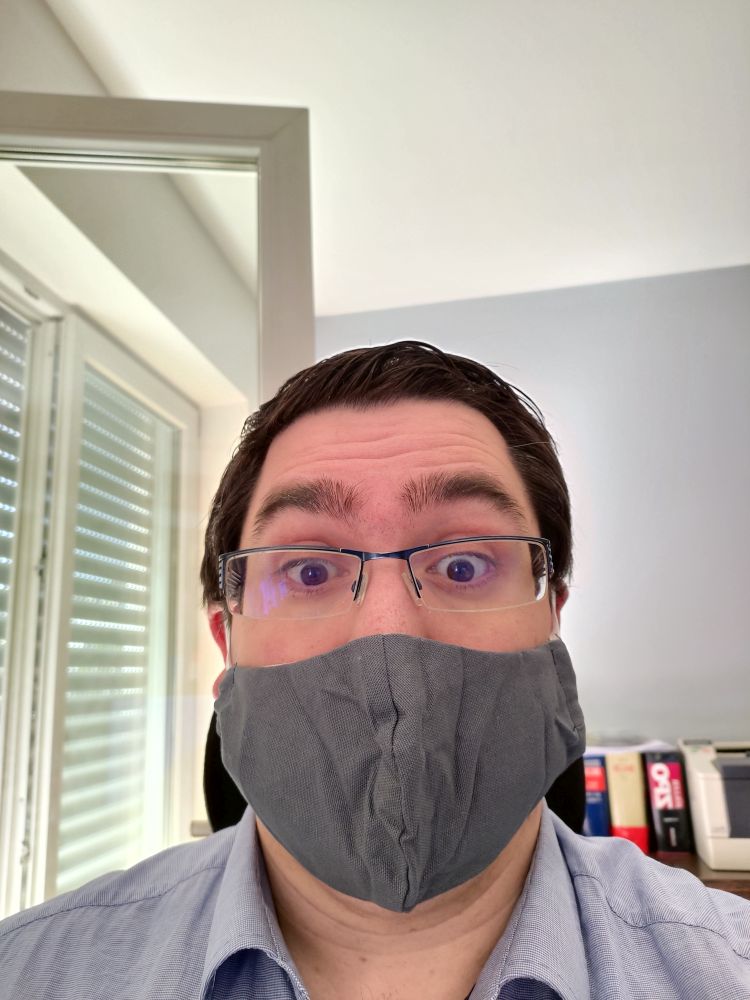
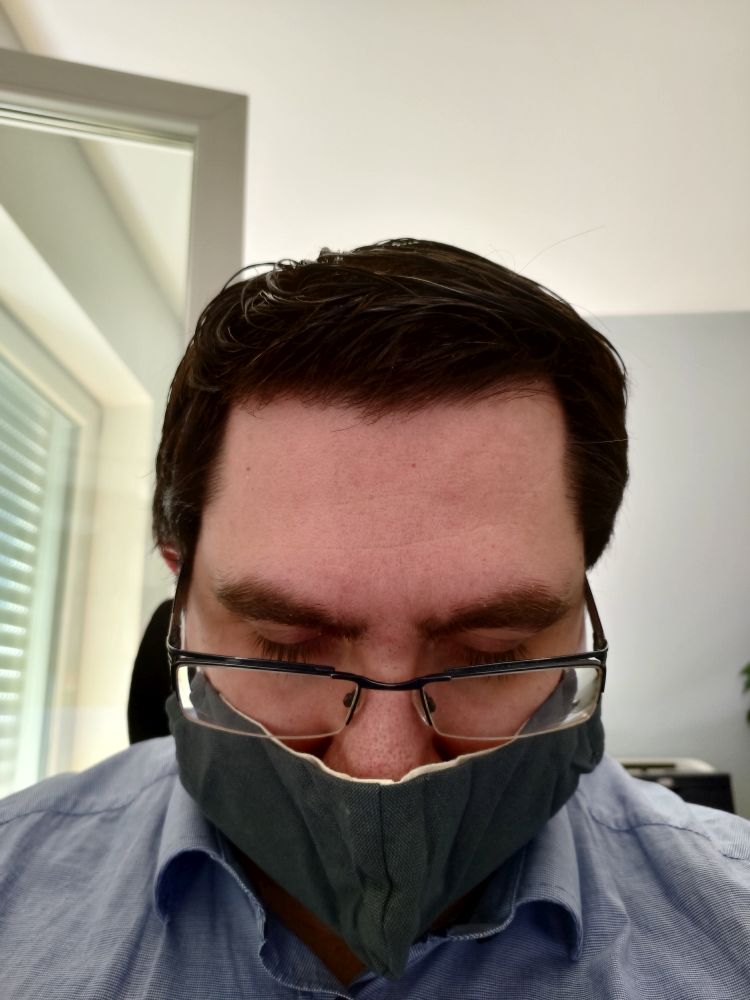
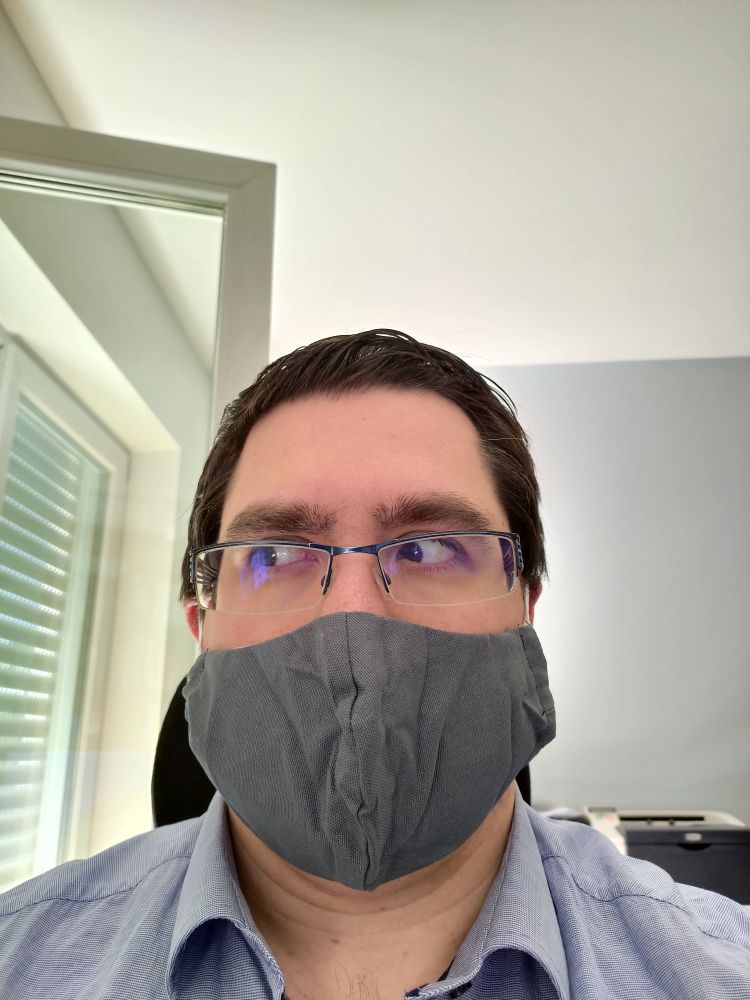
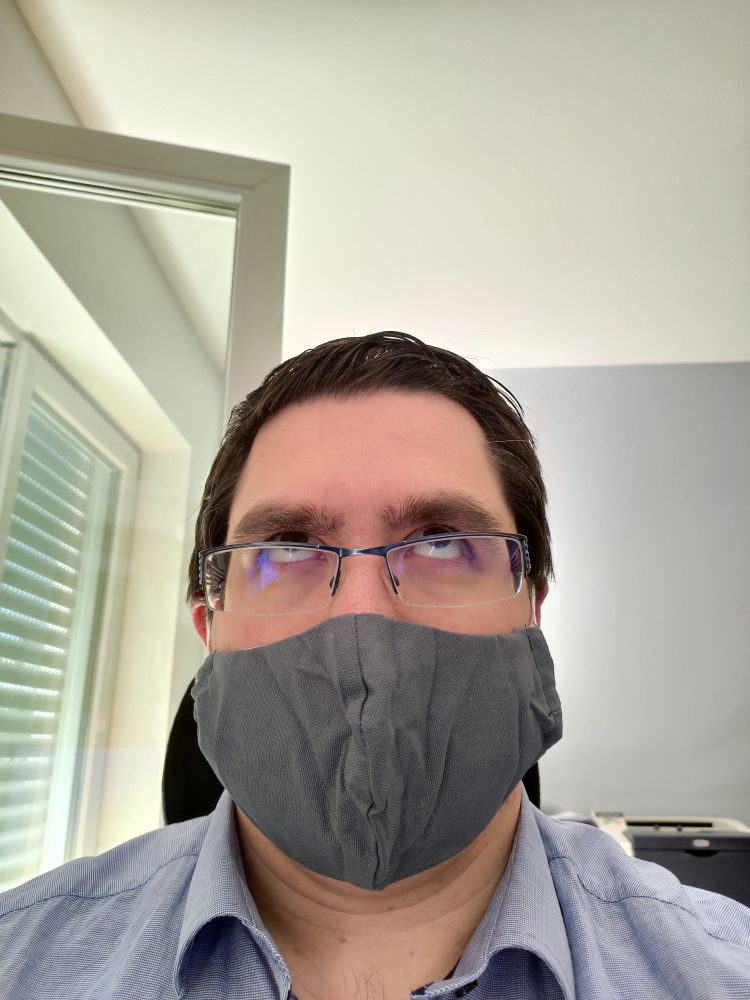



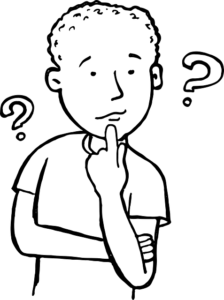

 Es gibt Termine, die sind unnötig, es gibt Termine, die sind komplett unnötig und es gibt Termine, bei denen man sicht fragt, was wohl schief gelaufen ist, dass der Kollege nicht das absolute Minimum getan hat, um den Termin zu verhindern. Auch Anwälte, die gerne zu Gericht gehen, opfern ja nicht gerne einen ganzen Vormittag, um ein Missverständnis aufzuklären, dass durch ein Telefonat hätte aufgeklärt werden können.
Es gibt Termine, die sind unnötig, es gibt Termine, die sind komplett unnötig und es gibt Termine, bei denen man sicht fragt, was wohl schief gelaufen ist, dass der Kollege nicht das absolute Minimum getan hat, um den Termin zu verhindern. Auch Anwälte, die gerne zu Gericht gehen, opfern ja nicht gerne einen ganzen Vormittag, um ein Missverständnis aufzuklären, dass durch ein Telefonat hätte aufgeklärt werden können.
