
Der Fall eines von der katholischen Kirche gekündigten Chefarztes, der es gewagt hatte, sich nochmals zu verheiraten, beschäftigt nun ein weiteres Gericht. Nachdem der Chefarzt gegen die Kündigung geklagt hatte, hatte er von allen Instanzen, zuletzt vom BAG mit Urteil vom 8.9.2011 – Az. 2 AZR 543/10, Recht bekommen, bevor das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung kassiert und die Sache an das BAG zurückverwiesen hat.
Der 2. Senat des BAG hat in der zweiten Runde nun mit Beschluss vom 28.07.2016 – Az. 2 AZR 746/14 (A) – entschieden (Pressemitteilung), die Sache vorerst nicht selbst zu entscheiden, sondern dem EuGH gem. Art. 267 AEUV folgende Fragen vorzulegen:
1. Ist Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (RL 2000/78/EG) dahin auszulegen, dass die Kirche für eine Organisation wie die Beklagte des vorliegenden Rechtsstreits verbindlich bestimmen kann, bei einem an Arbeitnehmer in leitender Stellung gerichteten Verlangen nach loyalem und aufrichtigem Verhalten zwischen Arbeitnehmern zu unterscheiden, die der Kirche angehören, und solchen, die einer anderen oder keiner Kirche angehören?
2. Sofern die erste Frage verneint wird:
a) Muss eine Bestimmung des nationalen Rechts, wie hier § 9 Abs. 2 AGG, wonach eine solche Ungleichbehandlung aufgrund der Konfessionszugehörigkeit der Arbeitnehmer entsprechend dem jeweiligen Selbstverständnis der Kirche gerechtfertigt ist, im vorliegenden Rechtsstreit unangewendet bleiben?
b) Welche Anforderungen gelten gemäß Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 2 der RL 2000/78/EG für ein an die Arbeitnehmer einer Kirche oder einer der dort genannten anderen Organisationen gerichtetes Verlangen nach einem loyalen und aufrichtigen Verhalten im Sinne des Ethos der Organisation?
Bis zur Beantwortung ist das Verfahren beim BAG nun ausgesetzt. Und ein weiteres Gericht darf sich nun – europarechtlich – mit der Frage auseinandersetzen, ob die Kirchen wirklich Arbeitnehmer diskriminieren dürfen sollen, nur weil sie sich nicht ihren Vorstellungen konform im Privatleben verhalten. Bei allen anderen Arbeitgebern wäre eine solche Frage absurd, aber es gelten ja die Sonderrechte der Kirchen…
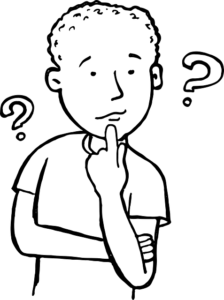
 Viele allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) enthalten Klauseln, wonach Erklärungen nur dann wirksam sein sollen, wenn sie schriftlich (also handschriftlich geschrieben und/oder unterzeichnet) abgegeben werden. Insbesondere in Arbeitsverträgen sind im Rahmen von sog. Ausschlussfristen Regleungen enthalten, wonach Ansprüche verfallen, die nicht binnen X Monaten schriftlich geltend gemacht wurden.
Viele allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) enthalten Klauseln, wonach Erklärungen nur dann wirksam sein sollen, wenn sie schriftlich (also handschriftlich geschrieben und/oder unterzeichnet) abgegeben werden. Insbesondere in Arbeitsverträgen sind im Rahmen von sog. Ausschlussfristen Regleungen enthalten, wonach Ansprüche verfallen, die nicht binnen X Monaten schriftlich geltend gemacht wurden.