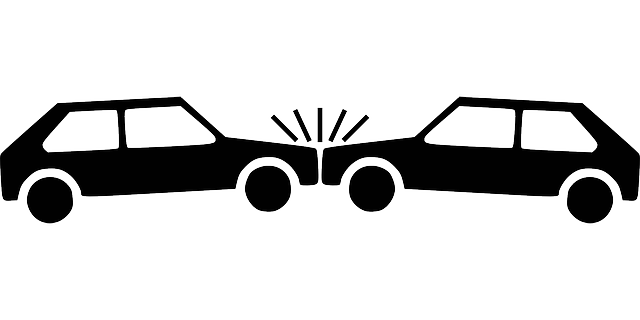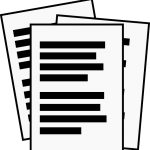Mit Urteil vom 10.07.2014 – Az. 2 U 101/13 – hat das OLG Naumburg (bisher nur bei beck-online unter BeckRS 2014, 16163 veröffentlicht) bestätigt, dass auch das Regulierungsverhalten des Haftpflichtversicherers bei der Bemessung des Schmerzensgeld eine (entscheidende) Rolle spielt.
Im entschiedenen Fall ergab sich eine (Teil-)Schmerzensgeldsumme von 150.000 €, die erheblich über dem eigentlich auszuurteilenden Betrag lag. In Fortführung der Rechtsprechung anderer OLGs hat das OLG Naumburg die Verzögerungstaktik der Haftpflichtversicherung bei der Regulierung als ganz erheblich das Schmerzensgeld erhöhendes Kriterium gewertet.
So das Gericht in seiner Urteilsbegründung:
e) aa) Das Schmerzensgeld ist aufgrund der vorgenannten Umstände mit 150.000,00 Euro zu bemessen. Eine Vergleichbarkeit mit dem vom Landgericht angeführten Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg (Urteil vom 25.04.1997, VersR 1998, 732) ist gegeben. Aber auch eine Vergleichbarkeit mit dem Sachverhalt, welcher der von der Beklagten selbst vorgelegten Entscheidung des Oberlandesgerichts Brandenburg (Urteil vom 23.06.2011, 12 U 263/08, Schaden-Praxis 2011, 361) zugrunde gelegen hat, ist anzunehmen. Allerdings ist, worauf die Klägerin zutreffend hinweist, in dieser Entscheidung allein deshalb auf ein Schmerzensgeld von nur 75.000,00 Euro erkannt worden, weil sich die dortige Geschädigte ein hälftiges Mitverschulden hat anrechnen lassen müssen.
bb) Zwar ist zu berücksichtigen, dass die Klägerin, anders als in den von den Oberlandesgerichten Nürnberg und Brandenburg entschiedenen Rechtsstreiten, in denen eine 34-jährige Frau bzw. ein 38-jähriger Mann geschädigt worden waren, und auch anders als in der von der Beklagten zitierten Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm, bei der es um den Unfall eines 16-Jährigen ging (Urteil vom 25.09.2002, 13 U 62/02, DAR 2003, 118), im Unfallzeitpunkt bereits 66 Jahre alt war. In diesem Zusammenhang hat der Bundesgerichtshof es als sachgerechtes Kriterium benannt, dass ein verhältnismäßig alter Geschädigter (dort 73 Jahre alt) keinen so langen Leidensweg vor sich habe wie ein jüngerer Mensch und dass deshalb bei ihm im Verhältnis zu einem jungen Verletzten ein geringerer Schmerzensgeldbetrag angemessen ist (Urteil vom 15.01.1991, BGH VI ZR 163/90, NJW 1991, 1544).
cc) Dies führt im Ergebnis aber deshalb zu keiner anderen Bemessung des Schmerzensgeldes, weil aufgrund des zögerlichen Regulierungsverhaltens der Beklagten ein erheblicher Schmerzensgeldaufschlag gerechtfertigt ist, der den vorgenannten, wegen des Alters der Klägerin vorzunehmenden „Abzug“ vollständig ausgleicht (vgl. zu diesem Schmerzensgeld erhöhenden Kriterium: OLG Nürnberg, Urteil vom 22.12.2006, 5 U 1921/06; OLG Naumburg, Urteil vom 28.11.2001, 1 U 161/99 sowie Urteil vom 15.10.2007, 1 U 46/07, jeweils zitiert nach juris; OLG Köln, Urteil vom 09.08.2013, 19 U 137/09, NJW-Spezial 2014, 75).
[…]
Die Beklagte kann sich nicht auf – an sich zulässiges – Verteidigungsvorbringen berufen. Soweit sie auch in diesem Zusammenhang die Verletzungen und deren Folgen in Abrede gestellt, kann dem, wie ausgeführt, keine Bedeutung beigemessen werden. Es stand vielmehr fest, dass die Klägerin bei dem Unfall erheblich verletzt worden ist. Diese Verletzungen machten schon für sich genommen die Zahlung eines nicht unerheblichen Schmerzensgelds erkennbar erforderlich. Dass die Beklagte dennoch lediglich ca. ein Drittel des der Klägerin zustehenden Schmerzensgeldes ausgekehrt hat, stellte für diese eine Manifestierung der bereits erlittenen Schmerzen, aber auch die Zufügung weiteren Leides dar. Denn aufgrund des Nichterhalts des ihr erkennbar zustehenden Schmerzensgeldes ist es ihr über viele Jahre hinweg nicht möglich gewesen, sich die Annehmlichkeiten zu verschaffen, die die von ihr erlittenen Schmerzen zumindest teilweise hätten ausgleichen können. Darüber hinaus hat es der Klägerin bereits nach der Lebenserfahrung weiteres Leid verschafft, dass sie sich aufgrund der von der Beklagten vorgenommenen Verteidigungsstrategie, die von einem Bestreiten auch offensichtlich von der Klägerin wahrheitsgemäß vorgetragener Tatsachen, wie etwa der eingetretenen Verletzungen, geprägt gewesen ist, dem Anschein einer Simulantin ausgesetzt gesehen hat, der es allein um die Erlangung eines hohen – unberechtigten – Schmerzensgeldes gehe.
Angesichts der klaren Linie der OLGs in den letzten Jahren wird zu hoffen sein, dass die Haftpflichtversicherer in Zukunft – um höhere Schmerzensgeldzahlungen zu vermeiden – nicht mehr versuchen werden, eindeutig gegebene Ansprüche mit Händen und Füßen abzuwehren.