…heilen das auch Staatsanwaltschaft und Gericht meist nicht mehr.
Die Beamten des Polizeidienstes sind gem. § 163 StPO die Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft, mithin also deren verlängerter Arm. Staatsanwälte in der ganzen Republik müssen sich darauf verlassen, was die Polizei ihnen ins Kämmerlein schickt und oftmals wird deren Arbeit selbst dann nicht mehr hinterfragt, wenn sich Zweifel aufdrängen müsste. Schließlich ist man ja in Zukunft wieder auf deren Zuarbeit angewiesen. Deshalb werden landauf und landein täglich fleißig Anklagen und Strafbefehle geschrieben, die allein auf dem Bericht der Polizei beruhen und sich nicht die Mühe machen, deren Arbeit kritisch zu begutachten.
Über einen Musterfall solcher “Arbeit” hatte ich bereits hier, hier und hier berichtet. Im Rahmen der obligatorischen Berufungsinstanz – der Staatsanwaltschaft waren 8 Monate Freiheitsstrafe für einen Angeklagten, dessen Tatbeteiligung nicht erwiesen war, zu wenig – kamen noch mehr Details zu Tage, um die sich die Strafrichterin in der ersten Instanz nicht gekümmert hatte.
So war der Einsatzleiter der Polizei vor Ort , Polizeiobermeister M., “frisch von der Akademie” und hat noch nie an einem Einsatz dieser Art teilgenommen (erst recht nicht als Einsatzleiter). Alle Fragen dazu, was die Zeugen vor Ort gesagt haben, musste er mit Nichtwissen beantworten. Welche Kollegen denn noch vor Ort waren (immerhin 8 Stück)? Keine Ahnung. Warum diese in seinem Bericht nicht stehen? Weiß er nicht. Ob er mit diesen vor Fertigung seines Berichts nochmal gesprochen hat? Keine Ahnung. Ob denn stimmen kann, dass ein Kollege den Mitangeklagten habe gehen lassen? Schon möglich. Warum man die Namen der 8-10 Leute nicht aufgenommen habe, die da rumstanden? Naja, die haben ja gesagt, sie hätten nichts gesehen.((Notiz an alle Täter: Einfach behaupten, ihr habt nichts gesehen, dann lässt euch die Polizei gehen.)) Es habe sich ja auch keiner als Zeuge angeboten.((Weil Jugendliche auch so erpicht sind, mit der Polizei zu sprechen.)) Ob denn einer der Kollegen vor Ort per-Du mit dem “Opfer” war? Das könne schon sein, aber er weiß ja nicht mehr, wer denn vor Ort war.
Nachdem der “Frischling”-Polizist (drei Tage später) seinen Bericht über die Nacht geschrieben hatte, wunderten sich weder sein Vorgesetzter noch der nun ermittelnde Kriminalhauptkommisar (KHK) P., ein Mannsbild mit ca. 30 Jahren Berufserfahrung und überdies ein Bekannter des Vaters des “Opfers”, darüber, dass die anderen Polizisten vor Ort nicht als mögliche Zeugen (vom Hörensagen) im Bericht standen und machten sich auch keine Mühe, diese zu ermitteln. Dagegen wurde mit kriminalistischen Scharfsinn unser Mandant als dritter Täter ermittelt. Vom Gericht hierzu befragt, sagte er wörtlich, dass zwar “leider” keiner der Zeugen den Mandanten auf den Wahllichtbildvorlagen habe wiedererkennen können und er auch sonst keine objektiven Beweismittel habe, er sich aber trotzdem gang sicher ist, dass unser Mandant der dritte Täter war. Dies verwirrte sogar die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft und die Vorsitzende, sind doch Polizisten normalerweise nicht so ehrlich zuzugeben, dass sie sich auf einen Verdächtigen fixiert haben und versuchen, diesen gegen alle Widerstände als Täter zu “identifizieren”.
Auf meine Frage, wieso er spätestens nach dem dritten Fehlversuch nicht versucht hatte, andere Zeugen in Erfahrung zu bringen, berief er sich darauf, dass man doch eine Zeitungsannonce geschalten habe. Warum man nicht die Mitglieder des Burschenvereins befragt habe, die zahlreich vor Ort waren und alle das “Opfer” kannten? Das könne er jetzt so nicht sagen. Warum man die bekannten Zeugen nicht nach der Identität der weiteren 8-10 Personen gefragt hat, die das Geschehen beobachtet haben? Erschien nicht so wichtig. Warum man nicht das “Opfer” als Auslöser der Schlägerei verdächtigt hatte, obwohl Zeugen übereinstimmend berichtet habe, dass dieser ziemlich betrunken lautstark gestritten habe und die Tatverdächtigen schlichten wollten? Gab es keinen Anlass dazu, er war ja schließlich am Ende der Verletzte.
Das Verfahren führte also, wie berichtet, zur Anklage gegen unseren Mandanten und endete in 1. Instanz mit einer Verurteilung zu 8 Monaten Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung. In zweiter Instanz wurde das Verfahren gem. § 153a StPO gegen Zahlung eines geringen Betrags eingestellt.((Wozu der Mandant auch nur bereit war, um die Angelegenheit endgültig sicher zu erledigen, denn der Freispruch “lag in der Luft”.)) Die gefährliche Körperverletzung die die erste Instanz und auch die Staatsanwaltschaft gesehen haben wollen, war für das Berufungsgericht nur mit “Rosinenpickerei” zu rechtfertigen. Eine durchaus treffende Beurteilung der erstrichterlichen Beweis”würdigung”. Das wahre Tatgeschehen aber wird wohl nie mehr ermittelt werden können, mehr als 2 1/4 Jahre nach dem Vorfall. Daran ist die schlampige Polizeiarbeit nicht ganz unschuldig.
 Der BGH hat mit Urteil vom 14.12.2016 – Az.
Der BGH hat mit Urteil vom 14.12.2016 – Az. 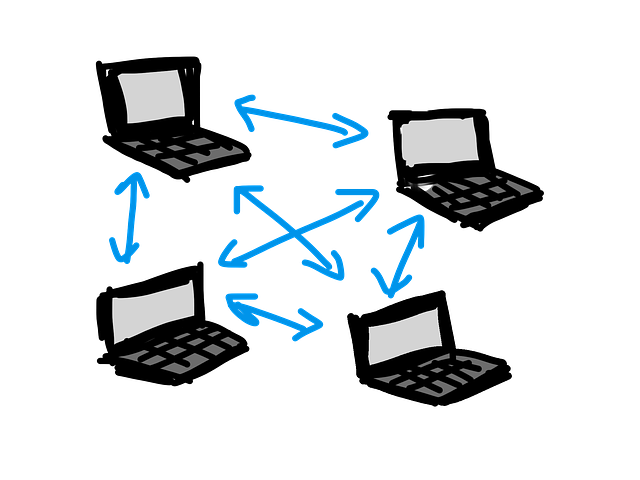

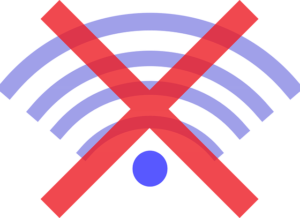 Der EuGH hat heute
Der EuGH hat heute 