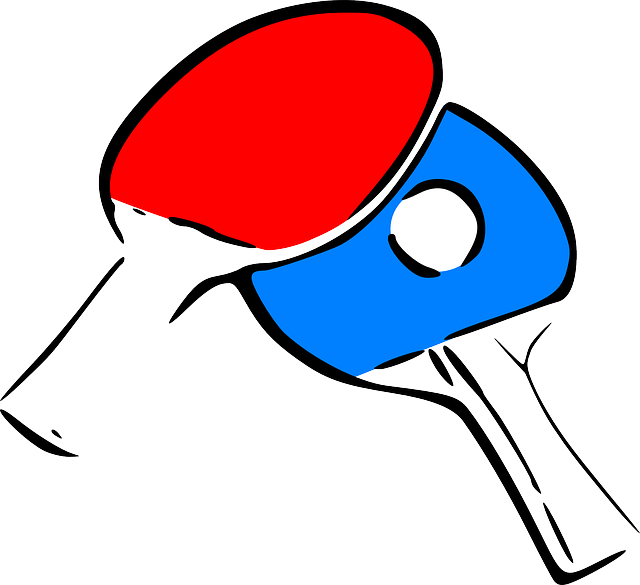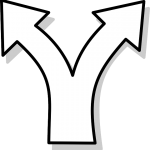Fehler zugeben ist etwas, was vielen Leuten schwer fällt. Juristen sind hierfür – berufsbedingt – vielleicht noch ein wenig anfälliger als andere Berufsgruppen, insbesondere im Staatsdienst.
Wenn also ein Staatsanwalt eine Anklage geschrieben hat – insbesondere wenn vorher schon alle Zeugen der Polizei gesagt haben, dass sie den Beschuldigten trotz dreifacher Wahllichtbildvorlage nicht wiedererkennen – dann kann er oftmals nicht einsehen, dass seine schöne Anklage das Papier nicht wert ist, auf dem sie gedruckt wurde.
So im Rahmen der Hauptverhandlung in der oben verlinkten Sache. Alle Zeugen – allesamt aus dem Lager der angeblich Geschädigten (weil keiner der 10+ sonstigen Zuschauer für die Polizei als Zeugen in Frage kam) – haben wortwörtlich ausgesagt, dass sie den Mandanten nicht als Täter erkennen (wie ja auch der Polizei schon gesagt) – insbesondere auch die in der Anklage zitierte Hauptbelastungszeugin A. Auch die beiden Mitangeklagten haben zwar eingeräumt, beteiligt gewesen zu sein, die Anwesenheit des Mandanten aber ausdrücklich verneint.
Im folgenden Rechtsgespräch (um einen Fortsetzungstermin zu verhindern) sagt die Staatsanwältin angesichts dieser Beweisaufnahme, dass sie “vollkommen überzeugt” von der Mittäterschaft des Mandanten ist, dessen Anwesenheit bereits alle Beteiligten verneint haben. Woher sie diese Überzeugung nimmt, konnte sie aber nicht erklären…1
PS:
Als der ermittelnde Polizeibeamte gefragt wurde, wie er denn auf unseren Mandanten als Mittäter gekommen ist, war seine Logik sinngemäß:
Der dritte Täter hatte eine rote Baseballmütze auf. Der Mandant wurde 2010 mal von der Polizei mit einer Baseballmütze (Farbe unbekannt) angetroffen. Wir wissen also, dass er eine Baseballmütze hat und die anderen Angeklagten kennt. Daraus habe ich messerscharf geschlossen, dass er das gewesen sein muss.2
1 Dass mein Vertrauen in die “objektivste Behörde der Welt” bei solchen Staatsanwälten/-innen weiter schwindet, dürfte jedem einleuchten.
2 Eine weitere Sternstunde bayerischer Ermittlungstätigkeit.