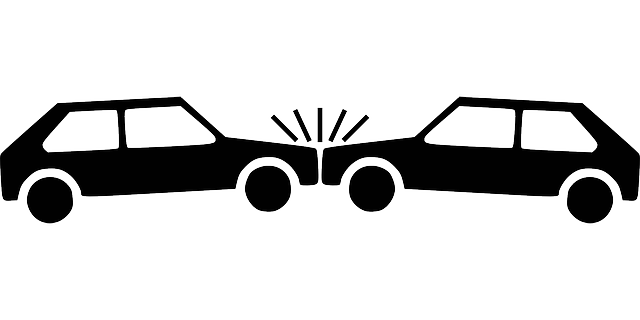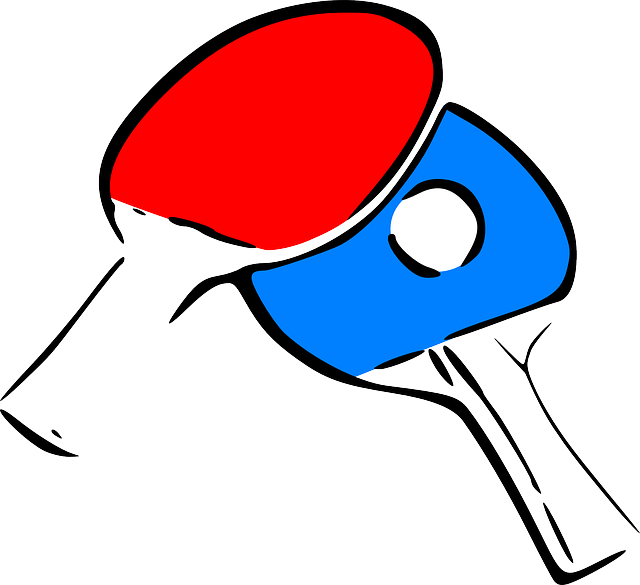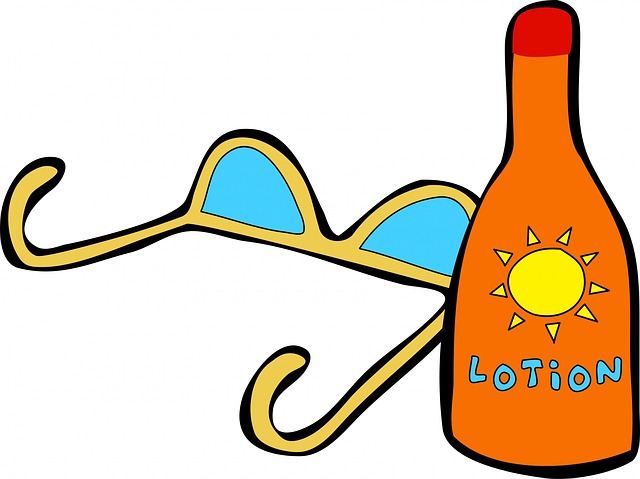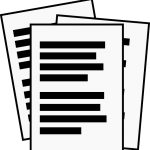Am Dienstag hatte ich von einem klausurwürdigen Fall am hiesigen Amtsgericht berichtet. Nur ein Kommentator hat sich getraut, eine Einschätzung abzugeben. Die dortige Beurteilung von Robin Wiemert entspricht dem, was ich erwartet hätte, wenn man diesen Fall als Klausur stellen würde.
Im Detail:
Im Strafrecht gilt grundsätzlich, dass zur Bestrafung immer erforderlich ist, dass Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld bejaht werden können. Die Schuld ist gem. § 20 StGB auch dann ausgeschlossen, wenn der Rausch einen Grad erreicht hat, bei dem der Täter nicht in der Lage ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen und/oder gemäß dieser Einsicht zu handeln.
Im vorliegenden Fall entfällt daher die ansonsten zu bejahende Strafbarkeit nach §§ 142, 315c, 316 StGB wegen fehlender Schuld.
Möglich bleibt in solchen Fällen eine Strafbarkeit nach § 323a StGB (Vollrausch). Tathandlung des § 323a StGB ist nämlich nicht die Teilnahme am Straßenverkehr oder die Unfallflucht, sondern das Sichberauschen, welches zu der o. g. Nichtstrafbarkeit führt. Der Täter soll daher dafür bestraft werden, dass er sich berauscht hat, obwohl er damit rechnen konnte, dass er bestimmte Taten (nicht unbedingt Straftaten) begehen wird*.
Wie bei jeder Tat muss der Strafrichter jedoch Feststellungen dazu treffen, ob die Tathandlung tatsächlich begangen wurde, also hier, ob A sich tatsächlich vorsätzlich oder fahrlässig selbst(!) einen solchen Rausch angetrunken hat (vgl. OLG Köln, Blutalkohol 47, 296; BGH, Beschluss vom 08.12.1992 – Az. 4 StR 562/92). Ist er dazu nicht in der Lage, weil nicht zu ermitteln ist, wieso der Angeklagte berauscht war, so muss er zu seinen Gunsten davon ausgehen, dass dieser sich nicht selbst berauscht hat und ihn also folgerichtig auch freisprechen.
Die Antwort auf meine Frage lautete also: A ist gar nicht zu bestrafen, möglicherweise kann ihm aber nach § 69 I StGB die Fahrerlaubnis entzogen werden.
Praxis?
Die ein oder der andere fragt sich wohl, was diese Ausführungen mit der Überschrift zu tun haben. Ganz einfach: Das war die Theorie.
Die Praxis sieht leider anders aus. Verurteilt wurde A nämlich doch wegen § 323a StGB. Obwohl die Tathandlung weder ermittelt noch festgestellt wurde, ging das Gericht davon aus, dass aus dem Zustand des Berauschtseins geschlossen werden könne, dass A sich selbst berauscht hat.** An manchen bayerischen Gerichten ticken die Uhren halt anders als im restlichen (Rechts-)Staat.
* Berauscht er sich nur, um schuldlos Straftaten zu begehen, so wird er über die Rechtsfigur der “actio libera in causa” für die Straftaten selbst bestraft)
** Dazu der BGH a. a. O.:
Die Verurteilung wegen Vollrausches setzt die zweifelsfreie Feststellung voraus, daß der Täter sich in einen Rausch versetzt hat. Ein Schuldspruch wegen Vollrausches scheidet dagegen aus, wenn das “Ob” der Berauschung zweifelhaft ist.